Liebe Helga Müller, Sie sind Galeristen in Stuttgart und haben gemeinsam mit Ihrem mittlerweile verstorbenen Gatten zu Ende des 20. Jahrhunderts etwas Spektakuläres für die Kunst geleistet. Dazu möchte ich Ihnen heute einige Fragen stellen.
Helga König: Sie haben gemeinsam mit Ihrem 2009 verstorbenen Gatten Hans-Jürgen Müller 1985 das Zukunftsprojekt "ATLANTIS" ins Leben gerufen. Können Sie den Lesern von "Buch, Kultur und Lifestyle" berichten wie es dazu kam?
![]() |
Helga Müller
Galeristin |
Helga Müller: Mein Mann gehörte zu den progressivsten Galeristen nach dem Krieg, er eröffnete 1958 in Stuttgart seine erste Galerie mit Ausstellungen von Cy Twombly, Frank Stella, Morris Louis – Baumeister, Dieter Roth, Arnulf Rainer etc. Er war Mitbegründer des 1. Kunstmarkts in Köln 1967 und erlebte in der Folge mit großer Betroffenheit den zunehmend stärker werdenden spekulativen Umgang mit Kunst. Für ihn – den "Überzeugungstäter" und Liebhaber der Kunst und der Künstler – war das der Grund, 1973 seine in der Zwischenzeit in Köln eröffnete Galerie zu schließen und sich nach Teneriffa zurückzuziehen, wo er das als "Kultbuch" berühmt gewordene Buch "Kunst kommt nicht von Können" schrieb, das seine Überzeugungen und Vorstellungen vom Umgang mit Kunst gut beschreibt. 1977 kehrte er nach Stuttgart zurück, wo er mit Max Hetzler und Ursula Schurr die Ausstellung "europa ’79" auf die Beine stellte, die allererste Ausstellung über die Kunst der 80er Jahre überhaupt.
1982 gingen wir beide dann nach Köln, wo damals "die Musik" spielte. Wir übernahmen die Galerieräume von Paul Maenz in der Schaafenstraße 25 und bauten eine große Sammlung auf "Tiefe Blicke", die inzwischen im Hessischen Landesmuseum in Darmstadt hängt. Die 80er Jahre waren geprägt durch den Neoexpressionismus der sog. "Jungen Wilden" und gingen einher mit einer extremen Zunahme, Kunst als Geldanlage, als Spekulationsobjekte zu behandeln. Nach einem Besuch im "Hammerstein’s"– dem In-Lokal damals in Köln und Treffpunkt der gesamten Kunstszene –, wo es ausschließlich um Kunstpreise und nicht mehr um -Qualitäten oder gar Inhalte ging, kamen wir völlig deprimiert in die Galerie zurück und überlegten gemeinsam in dieser Nacht, was wir beide denn gegen diese totale Kommerzialisierung von Kunst – und nicht nur der Kunst, nein aller kulturellen Bereiche – tun könnten.
Wir fragten uns, was der "Welt" im Grunde genommen fehle und kamen zu dem Ergebnis, dass uns die Schönheit und die Kultur verloren gegangen waren. Wir verglichen den Zustand unserer Gesellschaft mit dem von Platon im Tamaios beschriebenen Zustand der Gesellschaft im alten ATLANTIS – das von den Göttern in "einer Nacht" zum Untergang verdammt wurde und in den Fluten versank. – Deshalb der Projekt-Name ATLANTIS! Wir sahen viele Parallelen – unser Größenwahn, der Abfall vom Spirituellen, die Habgier und Rücksichtslosigkeit in der Bevölkerung und ihren "Führern"… und wir beschlossen, der Welt zum bevorstehenden Jahrtausendwechsel ein Geschenk zu machen – gemeinsam mit Gleichgesinnt- und –betroffenen: Einen Ort der Schönheit und der Kunst zu schaffen – als Raum, in dem der Mensch wieder erfahren könnte, was wir verloren haben, und als Quelle der Inspiration und der Entwicklung neuer Modelle einer lebenswerten – von ethischen Maßstäben geprägten Zukunft. Ein Think Tank, der kleine Gruppen von Verantwortungsträgern aus Wirtschaft, Politik und Wissenschaft zusammenbringen soll mit Querdenkern und Künstlern, um die damals schon erahnbare, heute in erschreckender Weise Wirklichkeit gewordene Entwicklung umzukehren.
Bis 1992 beauftragten wir bedeutende Architekten – Leon Krier, Frei Otto und andere – mit der Entwicklung von Plänen, wie ein solcher Ort aussehen könnte. Die Entwürfe von Krier gingen in großen Ausstellungen um die ganze Welt – vom Moca in Los Angeles bis Tokio, von Frankfurt bis Bologna, vom Museum Ludwig in Köln bis nach Yale… Die Entwürfe von Frei Otto – als "Pilotpro-jekt" mit dem Namen MARIPOSA benannt – wurden in Santa Cruz de Tenerife mit großer Medienwirksamkeit vorgestellt. 1992 waren wir von Jan Hoet eingeladen, ATLANTIS auf der documenta IX zu präsentieren, wo wir im eigenen Pavillon 100 Tage mit jedem an diesem Konzept interessierten Besucher Ziele und Möglichkeiten dieses Projekts zu diskutieren.
Helga König: 1992 dann erfolgte die ATLANTIS Kultur-Preisstiftung. Was hatte es damit auf sich?
Helga Müller: 1985 kehrten wir aus Köln nach Stuttgart zurück und eröffneten 1987 in der Ostendstraße 105 neue Räume, die so angelegt waren, dass sie auch als Basisbüro zur Realisierung von ATLANTIS würden genutzt werden können. Wir zeigten zeitgenössische Kunst, Volkskunst, ethologische Kunst und gutes Design – wenn Sie so wollen war es die erste "Life-Style-Galerie" in Deutschland überhaupt. Gleichzeitig trieben wir die Realisierungspläne für unser Projekt voran. Mit einem speziell gefertigten Wohnmobil fuhren wir zu jedem in Europa, der sich für dieses Projekt interessierte und Partner würde sein können.
Was uns dabei immer deutlicher bewusst wurde war, dass die "wahren Helden", die sich für Kultur, Ethik, für die mit Geld nicht erwerbbaren Werte selbstausbeuterisch betätigten, von den Medien nicht begleitet – also nicht "sichtbar" wurden und somit auch kein Diskurs in der Öffentlichkeit über die radikalen humanistischen Veränderungen stattfanden.
Wir beschlossen, eine Stiftung zu gründen, die diesem Manko abhelfen sollte – Die ATLANTIS-Kulturpreis-Stiftung. Sie sollte diejenigen durch die Verleihung eines nicht mit Geld dotierten Preises ehren, deren großen kulturellen Leistungen ungesehen und unkommentiert blieben. Gemeinsam mit einem unserer ganz alten Künstlerfreunde, Erich Hauser, fanden einige der Preisverleihungen auch in Rottweil statt. Preisträger waren u.a.: • Prof. Dr. Heinrich Klotz (Direktor des ZKM Karlsruhe) und vorher des DAM, Frankfurt • Prof. Dr. Bazon Brock (Prof. f. Ästhetik, Uni Wuppertal Laudatio: Rochus Kowallek • Helmut A. Müller (Hospitalhof, Stuttgart) Laudatio: Prof. Dr. Eugen Drewermann, • Dr. Alexander U. Martens (ZDF-Aspekte)/Laudatio: Prof. Dr. Hilmar Hofmann • Jörg Krichbaum (Autor)/ Laudatio: Peter Iden (Feuilleton-Chef Frankfurter Rundschau) Die ATLANTIS-Kulturpreis-Stiftung besteht nach wie vor – ihre Umwandlung in eine MARIPOSA –Stiftung strebe ich seit ein paar Jahren an. Vorbereitende Gespräche mit dem Staatssekretär im Wirtschaftsministerium von Baden-Württemberg fanden statt, die Statuten sind abgestimmt, - es fehlen bisher die Zu-Stifter – ich würde MARIPOSA selbst in die Stiftung einbringen!
Helga König: Ein Jahr später begannen die Bauarbeiten für das Kulturprojekt MARIPOSA in Arona auf Teneriffa. Können Sie näher schildern, was dort konkret entstanden ist und zu welchen Zwecken man den Kunstpark seitdem nutzt?
![]() |
Helga Müller
Galeristin |
Helga Müller: Im Zusammenhang mit dem großen Medienrummel, den das Projekt ATLANTIS losgetreten hatte und unserer Teilnahme an der documenta IX, entschloss sich der SWR, Rudij Bergmann damit zu beauftragen, einen Film über unsere Arbeit als Galeristen und ATLANTIS-Projekt-Entwickler zu drehen. Das Team kam dazu auf die documenta, in unsere neuen Räumen in der Ostendstraße und – wollte auch auf Teneriffa filmen, wo es außer unserem, schon 1973 erworbenen Grundstück noch nichts zu sehen gab.
Eine aufgelassene Finca von 2.5 ha mit drei Palmen, vielen zerborstenen Natursteinmauern und ein paar Mauerresten ehemaliger bäuerlicher Gebäude. In Vorbereitung auf das Film-Team, das auch tatsächlich nach Teneriffa kam, begannen wir mit den ersten Bau-Maßnahmen in Form der Errichtung einer ersten Begrenzungsmauer entlang der Straße und der Erweiterung eines kleinen bestehenden Baus, in welchem bis dahin Geräte für den Ackerbau weggeschlossen worden waren. Ich ließ ihn zu einem kleinen Haus ausbauen, damit die ersten Künstler einen Ort hätten, wo sie wohnen könnten und kaufte ein paar Pflanzkübel mit subtropischen Gewächsen, damit die Kameras etwas zu filmen hätten. – Dies war der Stand, als der SWR kam.
In dem Film "Mensch Müller, lass‘ die Welt doch untergeh‘n" war insofern auch kein einziger Schnitt, auf dem das heutige MARIPOSA zu sehen war… Am letzten Tag der documenta trafen wir in Kassel auf ein Künstlerpaar, das Straßenkunst machte – ich würde sagen eine Art "Pflastermalerei", aber so poetisch, dass mein Mann und ich die beiden ansprachen, um sie zu fragen, woher sie kämen und ob sie sich vorstellen könnten, gestalterisch an MARIPOSA mitzuwirken. Sie lebten, man höre und staune! auf Teneriffa… Der 1. bedeutsame "Zufall" in der Entstehungsgeschichte des Kulturparks MARIPOSA …
Wir konnten sie gewinnen, ab dem 11. Januar 1993 ihre Arbeit bei uns aufzunehmen. Sie verwandelten das kleine Haus in ein Juwel – heute ist es das "Sternhaus" wegen seiner originellen Dachkonstruktion in Form eines Sterns. Sie schufen das "Belvedere"– den Aussichtspunkt auf MARIPOSA, der den weitesten und schönsten Blick über die Küsten des Südens erlaubt und auch von seiner Konstruktion her eine einzige Augenweide ist.
Ihre gestalterischen Ideen setzten Maßstäbe für die weitere Entwicklung des Geländes. Wir erkannten, dass dies – wollten wir die Menschen wirklich in ihrem Inneren erreichen – nicht mit unseren, in der bildenden Kunst erworbenen hohen Ansprüchen an Reduktion und Abstraktion – zu erreichen war, sondern mit einer Formensprache, die unabhängig wäre vom Bildungsstand der Besucher und Gäste.
Für meinen Mann und mich war diese Erkenntnis ein "langer Weg"– er dauerte fast ein ganzes Jahr. Hans-Jürgen Müller, in der Kunstszene bekannt "wie ein bunter Hund", und unser Projekt waren in Künstlerkreisen damals ein wichtiges Gesprächsthema.
Viele meldeten sich bei uns und fragten uns, ob sie dazu einen Beitrag leisten könnten, dürften. Wenn man weiß, was einen Künstler in seinem Werk ausmacht, vermag man auch, sich vorzustellen, ob er sich mit der eigenen Vision verbinden lässt oder nicht. Dies war das einzige Kriterium, das uns dann veranlasste, ihn einzuladen. Wir zahlten den Flug, die Unterbringung, die Verpflegung und die Materialien für die geplante Arbeit, nachdem wir uns hatten erzählen lassen, welche Ideen er realisieren wollte. Vielleicht illustriert es ein wenig, wenn ich Ihnen erzähle, dass ich jedem Künstler bei seinem 1. Aufenthalt auf MARIPOSA ein ganz besonderes Buch in die Hand drückte: einen Bildband über die Katsura-Villa in Kyoto, den Palast der japanischen Kaiser aus dem 15./16. Jhdt. und Vorbild für die großen Architekten des Bauhaus.
Ich bat sie, sich dieses Buch genau anzusehen, über die Insel zu fahren und sich die alte Bausubstanz auf Teneriffa "einzuverleiben", die Materialien der Insel, die Farben und die subtropische Vegetation. Dann erst – wenn sie alles zu einem "inneren Bild" würden verbunden haben, sollten sie sich "ihren Platz" innerhalb des Geländes suchen und "den Platz fragen, was der Platz will"– erst dann könne ein Werk entstehen, das sich mit dem Ort auch verbinde…
So entstand – zunächst wie beim Legen eines 6000 Teile-Puzzles – eine Art "Flickenteppich" von gestalteten Plätzen, singulären Kunstwerken oder Kunsträumen. Über 80 Künstler aus aller Welt haben im Laufe der letzten 20 Jahre an MARIPOSA mitgewirkt. Die verbindenden Wege, Plätze, Gärten, Zonen des Spiels und der Kontemplation, all das waren weitgehend gestalterische Entscheidungen meines Mannes. Ich übernahm meist die Innengestaltung der Häuser und Jurten. Jedes Haus ist eine eigene, ganz besondere Welt, in der alles – bis zum Kaffeelöffel – bewusst ausgewählt worden ist. Mit jedem neuen Bereich, den wir angingen, wurde das Gelände "grösser"…
Ich sagte ja schon, dass es außer drei Palmen und einem uralten Pfefferbaum keinerlei Bäume gab. Aber dafür waren weite Bereiche des Geländes übersät mit Kakteen und stacheligen anderen Pflanzen, die ein Begehen so gut wie unmöglich machten. Die beiden Stuttgarter Geodäten, die uns angeboten hatten, ehrenamtlich das Land zu vermessen, waren "Krankenhaus-reif"“ danach…
Zunächst war die Herausforderung, die zusammengestürzten Trockenmauern des nach Süden abfallenden Geländes wieder zu errichten. An die zwölf kanarische Arbeiter waren dazu notwendig. Wege gab es keine mehr, aber die Topographie des Geländes und die schrittweise "Eroberung" des Landes mit ästhetischen Mitteln, die Knochenarbeit des Rodens weiter Kakteenfelder und die Bewegung der Menschen auf dem Land zeigten uns, wo die Wege laufen sollten. So entstand nach und nach eine erste Infrastruktur. Die kreativen Eingriffe der Künstler waren die Bezugspunkte für die beginnende Gartengestaltung und das Pflanzen von Bäumen, Büschen und anderen subtropischen Pflanzen.
Helga König: Können Sie Näheres zu den Arbeiten der Künstler auf und über MARIPOSA berichten?
Helga Müller: Nachdem der Architekt aus Madrid und seine Lebensgefährtin, eine Grafik-Designerin vom Nie-der-Rhein, im Januar 1994 ihre Arbeit beendet hatten, haben zwei Ulmer Künstler auf MARIPOSA als "Dauer-Gestalter" Einzug gehalten. Sie gingen daran, den westlich des Belvedere gelegenen oberen Bereich zu formen. Die ein Jahr zuvor auf der obersten Terrasse gepflanzten Bäume waren schon am Wachsen und mein Mann entschied, die Fläche mit einem besonderen Paviment zu verschönern – weiße Blumen aus Marmor in Ornamenten aus Basaltsteinen und Steinplättchen, die linienförmig die Topographie des Weges optisch ins Bewusstsein heben. Wasser ist innerhalb der Rossbreiten in subtropischen Trockenzonen wie die im Südwesten von Teneriffa von zentraler Bedeutung.
So entwickelte er gemeinsam mit den beiden jungen Künstlern – sie waren Ende 20 – die Idee, einen künstlichen Fluss anzulegen, dessen "Quelle" in Form einer Stahlskulptur in Herzform in der Werkstatt von Erich Hauser in Rottweil geschaffen worden war. Über drei Kaskaden fließt er nun in ein ovales Wasserbecken, um das sich sieben Sitzsteine gruppieren. Die Gäste nutzen es als kleinen Pool oder – wie bei den Mariposien® - als "Konferenztisch" völlig anderer Art.
Ein nach Süden künstlich aufgeschütteter Hügel, bepflanzt mit Agaven, Tabaiben und Bougainvilleas, schafft eine konzentrierte, dichte Atmosphäre – das Wasser trägt die Stimmen zum Gegenüber. Ein Nachbar hatte mich auf die Finca seiner Vorfahren mitgenommen, wo ich zum ersten Mal eine „Sommerküche“ sah, also eine Küche und „Esszimmer“ im Freien. Bei Jahresdurchschnittstemperaturen um die 21° C und mit wenigen Regentagen im Jahr, eine wunderbare "Erfindung"– man möchte gern immer im Freien sein. Im Bereich des Wasserbeckens schien mir der richtige Platz zu sein, auch auf MARIPOSA diese kanarische Tradition zu übernehmen. So entwickelte ich mit den beiden Künstlern die Idee ihrer Gestaltung, fertigte Zeichnungen an und schließlich wurde sie Realität. Auch ein geschlossener Küchenraum wurde benötigt, Kühlschrank, Spülmaschine, Vorräte – auch eine Toilette war vorzusehen. Die Sommerküche wurde zum zentralen Begegnungsplatz für alle Gäste seither.
Nach Süden pflanzten wir eine Hecke aus Rosmarin – und ein Feld ganz besonderer Wolfsmilchgewächse, die zu den Kakteen gezählt werden. Weiter und weiter ging es zu dem Bereich, der zum heutigen West-Eingang mit dem MARIPOSA –Tor führt. Ursula Stalder, eine Schweizer Künstlerin, die an den Stränden der Meere in aller Welt sammelt, was das Meer anspült, hatte uns mit ihren Arbeiten auf die Idee gebracht, zwei ihrer "Collagen"– Fundstücke aus Ägypten und Teneriffa in echten Museumskästen (die wir in Stuttgart hatten anfertigen lassen) – in einer „Kunst-Passage“ zu installieren, umrankt von Bougainvilleas. Robin Minard, Komponist elekt-ronischer Musik und Professor an der Musikhochschule in Weimar, fügte dem Schachplatz im Freien (ohne einen solchen ging es nicht bei meinem Mann) drei Klangtürme mit kleinen Laut-sprechern bei, deren zarte Klänge beim Spiel zum Horchen auffordern.
Die "Zuschauer" haben einen darüber liegenden Platz und eine Bank, von der aus sie die richtigen oder "falschen" Züge kommentieren können. Lassen Sie mich noch von einer Besonderheit sprechen, die einmalig ist: Im Zentrum des MARIPOSA–Geländes befindet sich ein Steinkreis mit einem Durchmesser von ca. 10 Metern, ein sog. "Tagoror". So nannten die Guanchen, die Ur-Einwohner der Kanaren, ihre "Thing-Plätze". Die Guanchen, wir würden sagen eine Steinzeit-Kultur, nutzten solche Plätze als die Orte, an denen die Menceys – die Könige und spirituellen Oberhäupter, von denen es zehn an der Zahl auf Teneriffa gab – um mit ihren Göttern in Kontakt zu treten.
Ein deutscher Archäologe, der in der Gemarkung Arona-Túnez über die Guanchen und ihre Geschichte forschte, klärte uns über diesen Sachverhalt auf. Im Bewusstsein, dass hier ein spiritueller Platz war, gaben wir unser Idee auf, einen der Künstler mit einem Riesen-Mosaik zu beauftragen. Ulrike Arnold, eine Land-Art Künstlerin, die in Düsseldorf und Utah lebt und arbeitet, hat dann die Oberfläche des Platzes mit Erdfarben aus Inselgestein bemalt, ein riesiges "informelles" Bild. Dort – gleich unterhalb – haben zwei brasilianische Künstlerinnen ein "Recycling-Objekt" besonderer Art geschaffen.
Gemeinsam mit unserem inzwischen fest angestellten Polier, der für die Technik zu sorgen hatte, entstand die "BAR 84"– mit einer richtigen Kühlanlage für Warsteiner-Bier. Alles geschaffen aus leeren Getränkedosen – Coca Cola – Fanta – Bier usw. Daneben – Richtung Westen und auf der großen Plaza, wo wir ca. 200 Leute bei Konzerten oder Vorträgen versammeln können – ein Feuerplatz für abendliche Runden und mit Grill – damit bei Festen auch der Gaumen nicht zu kurz kommt. Auf der Plaza haben die Künstler Thomas Stimm und Uta Weber einen Tanzplatz gestaltet, der Kölner Künstler Heinz-Josef Mess positionierte auf der Südseite einen Stein-Sessel, mit Blattgold belegt und Ort für das obligatorische Foto unserer VIP-Gäste.
Ich könnte noch seitenlang von all den Kunstwerken und –plätzen erzählen, die in den 20 Jahren seit Baubeginn auf MARIPOSA geschaffen wurden. Vielleicht ein paar Highlights: in der Galeria M hat der Frankfurter Künstler und Philosoph Frank Schubert seine Installation "Monadologie" nach Leibniz mit an die 350 Muschel-Szenarien geschaffen. An der Außenwand hängt eine Neon-Arbeit von Joseph Kosuth, die schon auf der documenta IX unseren Pavillon "beschrieb": "Manifestation – not description". Zwei Stahlskulpturen von Erich Hauser – eine aus Anfang der 70er Jahre – die andere aus 2004 erinnern an die Zusammenarbeit mit der Galerie Müller im Stuttgart der 60er Jahre. Stefan Demary zeigt mit seinem Discobol, der nicht nur den Diskus, sondern gleich seinen ganzen Arm mit wegschleudert, den Missbrauch von Meisterwerken europäischer Hochkultur, die als Gips-Replikate die Theken beim Italiener um die Ecke schmücken… Oder der "Bienengarten" von Jeanette Zippel mit seinen drei Riesen-Skulpturen für Wild- und Honigbienen. Vera Röhm: sie hat mit ihrer Installation "die Nacht ist der Schatten der Erde" eine weitere der beeindruckenden Arbeiten geschaffen mit ihren sechs schwarzen Metallkuben, die nachts leuchten. Oder Friedemann Grieshabers "Große Tragende"– eine ca. vier Meter hohe Beton-Skulptur in situ gegossen.
"Stein für MARIPOSA" nennt Valery Koshliakov aus Moskau seine Eisen-Skulptur, die unverkennbar russische Kunstgeschichte reflektiert. Oder die sechs Steinkreise von Herman de Vries, Heimat für die vielen wundervollen Monarch-Schmetterlinge, die es nur auf Teneriffa und in Mexico gibt… 9. 2000 fand die erste Veranstaltung auf MARIPOSA statt. Das erste Mariposion® hatte "Macht und Einfluss – Synergien wagen" zum Thema.
Helga König: Wer war damals vor Ort und zu welchen Ergebnissen gelangte man?
![]() |
Helga Müller
Galeristin |
Helga Müller: Aus meinem "Ersten Leben"– ich war viele Jahre in der Wirtschaft tätig – habe ich auch ein paar Jahre in Essen verbracht. Daher kannte ich das Stadt- und Landesprojekt "Essener Konsens", ein Zusammenschluss verschiedener bedeutender Industrieunternehmen in Essen, aber auch der Stadt Essen selbst und verschiedener ihrer Ämter. Entstanden aus der zwingenden Notwendigkeit, den Industrieraum Essen umstrukturieren zu müssen, da die Schwerindustrie mehr und mehr an Bedeutung verlor. Eingebunden war auch eine Institution, die den vielen Menschen, die ihre Stellung verloren hatten, durch Umschulungsangebote den Wiedereinstieg ins Berufsleben erleichtern soll – das BfZ – Berufsbildungszentrum Essen. Dessen Leiter, Norbert Meyer, hatte von MARIPOSA gehört und uns eingeladen, ihn einmal zu besuchen. Das Gebäude – ein Bau aus den frühen 60er Jahren mit viel Waschbeton und Glasbausteinen, dunkel und abweisend – aber praktisch – war ein Schock! Aber die Arbeit, die Norbert Meyer und sein Team dort leisteten beeindruckte uns sehr. Er wollte alles über MARIPOSA und unsere Zielsetzungen und Visionen wissen und war begeistert. Wir boten ihm an, seinen Verwaltungstrakt mit an die 60 Fotoarbeiten von MARIPOSA zu verschönern.
So fing unsere Verbindung Mitte der 90er Jahre an. – Er kaufte dann als Weihnachtsgeschenk für die mit dem BfZ verbundenen Unternehmen unsere Publikationen und verschickte sie. Im 3. Jahr schließlich – 1999 – erfuhr ich (auf Kopie einer Rund-Mail gesetzt), dass er zu einem Mariposion® einlud – angesprochen waren ca. 80 Personen. Mir blieb das Herz stehen. Ich rief ihn sofort an und fragte ihn, was er sich dabei gedacht hatte – denn, wie sollten wir auch nur ein Drittel dieser Menschen auf MARIPOSA unterbringen – unsere Kapazität lag damals bei maximal zehn Personen… Darunter waren auch Vorstände von RWE, VEW, Ruhrkohle und hohe Beamte. Aber er beschwichtigte und sagte, da sagen sowieso nicht mehr zu…
Schließlich ließ ich alles laufen und dachte, warten wir es ab. – Aber: meine Befürchtungen trafen zu – es waren 30 Zusagen eingegangen… Nun gibt es ja auf Teneriffa Hotels genug – aller Kategorien – aber meiner Meinung nach war der „Sinn der Übung“ ja nicht der, dass unsere Symposion-Teilnehmer außerhalb von MARIPOSA wohnen würden. Es blieb uns aber dann doch nichts anderes übrig als für viele der Gäste Hotelzimmer zu buchen. Es sollte unser 1. Mariposion® werden – sein Thema: Thema: “Macht und Einfluss – Synergien wagen” – und es ging insgesamt über ca. 16 Tage, wobei Anreise- und Abreisedaten und die Aufenthaltszeit unterschiedlich waren. Geleitet wurde es von Frau Dr. Mettler v. Meibom, Professorin an der Universität Essen, und Peter Helbig, einem Unterne hmensberater aus Essen und Freund von uns.
Das angewandte "Verfahren": Open-Space-Technik. Teilnehmer waren u.a.: Prof. Dr. Peter Brödner (Institut für Arbeit und Technik, Universität Essen), Dr. Axel Bürger (Ministerium für Arbeit und Soziales NRW), Marlis Drevermann (Kulturreferentin der Stadt Wuppertal), Peter Helbig (Unternehmensberater Essen), Prof. Dr. Barbara Mettler-v. Meibom (Universität Essen), Norbert Meyer (Vorstandsvorsitzender des BfZ Essen), Pfarrer Willi Overbeck (ev. Kirche Essen), Dr. Wilhelm Potthast (Vorstandsassistent RWE), Prof. Dr. Werner Springer (Universität Essen), Dr. Kurt Weiß (SAP AG) Dr. Irene Wiese-v. Ofen (Bau- und Planungsdezernentin NRW), Dr. Horst Zierold (Stadtkämmerer Essen) Im Schwerpunkt ging es darum, wie verschieden gelagerte Interessen und Bedingtheiten bei gemeinsamer Zielsetzung aber individuellen Machtansprüchen und Bedürfnissen zu Synergien würden finden können. Wer je versucht hat, vor einem solchen Hintergrund zu positiven Ergebnissen zu kommen, weiß wovon ich spreche. (Beispiel: Klima-, Wirtschafts-Gipfel…)
Rückblickend kann ich sagen: es war alles in allem ein voller Erfolg. Die ganz „wichtigen“ Verant-wortlichen – ich hatte es geahnt – wollten alle in einem 5-Sterne-Hotel untergebracht sein. Die Tatsache, dass ihnen zugemutet werden sollte, evtl. in Jurten zu nächtigen, trieb ihnen wahr-scheinlich den Schweiß auf die Stirn… Zum Frühstück kamen alle nach MARIPOSA - die vielen ver-schiedenen Plätze im Gelände und die Konferenzräume waren wie gemacht für das Open-Space-Modell, und die gemeinsamen Runden fanden in der mittlerweile leider nicht mehr existenten echten mongolischen Jurte statt, die dem Klima dort nicht Stand gehalten hat. Das abendliche Beisammensein aber – sei es in der Sommerküche oder unter dem uralten Pfefferbaum bei der Casa Dobermann – denke ich, war (wie auch später immer) wohl das wohl stärkste Gemeinschaft-stiftende Elixier… Interessant war, dass es keine drei Tage dauerte, bis die ersten VIP’s heimlich zu mir kamen und etwa folgendes zu mir sagten: …“der Sowieso reist doch am kommenden Montag ab. Meinen Sie, dass ich dann in seiner Jurte wohnen könnte?“… ich lachte mir heimlich eins ins Fäustchen und sorgte dafür, dass letztlich fast alle während ihres Aufenthalts ein paar Tage wenigstens bei uns auf dem Gelände wohnen konnten.
Die Aufgabe war: für die 20 Millionen, die das Land NRW und die Stadt Essen für ein wegweisen-des Projekt zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit zu geben bereit waren, ein Projekt zu entwickeln. – Das Projekt war dann: ein an das Gelände des BfZ angrenzendes Gebäude zu errichten, in dem jungen Start-Up-Unternehmern Berater aus allen möglichen Bereichen (von Unternehmen des Essener Konsens) kostenlos zur Verfügung gestellt würden. Das Projekt wurde ein paar Jahre später gebaut, und die Investition trägt seither Früchte.
Helga König: An welche Mariposien® der Vergangenheit erinnern Sie sich besonders gern und weshalb?
Helga Müller: Nun, natürlich an dieses allererste, das ich gerade versuchte zu beschreiben. - Im Jahr 2005 trat ein Stuttgarter Unternehmer an meinen Mann mit der Frage heran, er wolle ei-nen Musikpreis stiften – und ob meinem Mann dazu etwas Besonderes einfiele… Mein Mann erzählte mir anschließend davon, und ich sagte ihm, ob er eigentlich wisse, wie viele solcher Musikpreise es in Deutschland schon jetzt gebe… Wenn dieser Unternehmer also etwas Besonderes erreichen wolle mit der Auslobung, warum dann nicht auf einem ganz anderen Feld?
In all den Jahren unseres Bemühens, für MARIPOSA Partner zu finden, war uns klar geworden, dass die Gründe, warum dies so schwer geworden ist, vor allem in der mangelnden Vorstellungskraft unserer Zeitgenossen zu suchen ist. Vorstellungskraft und Phantasie sind eine Frage der Bildung. Wenn schon unsere eigene Generation nicht mehr darüber verfügt, dann – so wurde uns klar – was sollte dann aus der nachfolgenden Generation werden bei den Bildungskonzepten, die wir unseren Kindern schon seit Jahrzehnten zumuten? So schlug mein Mann dann vor, das vorgesehene Geld in ein Pilotprojekt zu investieren, in das 1. Jugend-Mariposion®, den 1. Baustein der MARIPOSA –Bildungsinitiative.
Bei einer der vielen Präsentationen von MARIPOSA, die wir in der Galerie von Dany Keller in München machten, war mir einer der Besucher durch seine große Aufmerksamkeit aufgefallen, und ich sprach ihn an. Es war ein Dr. Joachim Rossbroich – Philosoph und Soziologe -, der für die Hypobank in München die sog. Kempfenhausener Gespräche wissenschaftlich leitete. Vom Prinzip her ein sehr ähnlicher Ansatz wie unserer: nämlich die besten Köpfe der Welt einzuladen, um über Lösungswege gesellschaftlicher Problemstellungen zu arbeiten. Nicht als "Vortragende" vor einem Publikum, sondern bestenfalls mit einigen Hörern aus der Bank selber. Die Ergebnisse wurden dann von Dr. Rossbroich zusammengefasst und als Drucksachen den Kunden der Bank kostenlos zur Verfügung gestellt. Es war "ihr" Beitrag zur Lösung soziopolitischer Aufgabenstellungen und "Dienst am Kunden". Mit der Fusion der Hypobank mit Vereinsbank schied der zuständige Vorstand aus dem Unternehmen aus und die Reihe wurde nicht fortgesetzt.
Ich wusste also, dass ich ihn vielleicht würde für unsere eigene Bildungsinitiative gewinnen können und rief ihn an. Er erarbeitete ein Konzept zu einem zweiwöchiges Seminar für Oberstufenschüler. Das Geschwister-Scholl-Gymnasium in Stuttgart wurde eingeladen, 8 – 10 Schüler auszuwählen, die sich um das Stipendium bewerben mussten und im November 2006 flogen alle nach Teneriffa. Dieses 1. Jugend-Mariposion® vergesse ich nie, denn auch wir wussten ja nicht, ob unsere These tragen würde, nämlich, dass die Schönheit dieses Ortes und die Kunst als Fragesteller tatsächlich eine solche Bedeutung hätten, wie wir sie all die Jahre in unserer Vision vorausgesetzt hatten.
1990/91 geboren, sozialisiert also in diesen letzten 16/17 Jahren und aufgewachsen mit Pop und Computern, in einer rein ökonomisch orientierten Welt, permanenter Reizüberflutung und ohne wirkliche Erfahrung mit schönen Räumen und Kunst, veränderten sich in diesen zwei Wochen so spektakulär, dass wir unseren Förderer davon überzeugen konnten, sich auf fünf Jahre zu verpflichten, jährlich ein solches Mariposion® zu ermöglichen. Seither haben wir die Bildungsinitiative entscheidend weiterentwickelt.
Die weiteren Bausteine sind seit 2010 die Lehrer-Mariposien® und die Akademischen Bildungs-Mariposien®, die seit 2011 jährlich stattgefunden haben und für 2015 erneut geplant sind. Die Helmut Nanz-, die Bosch- und die Alison + Peter Klein-Stiftung waren bisher Förderer des Projekts. Wir suchen für alle drei Zielgruppen weitere Förderer. Es wäre – vor allem für die Jugend-Mariposien® – wünschenswert, dass zunächst wenigstens einem Gymnasium aus jedem unserer Bundesländer die Möglichkeit geboten würde, an solch einer außergewöhnlichen Bildungsmaßnahme teilzunehmen.
So ein Mariposion® kostet nicht mehr als eine ganzseitige Anzeige im Spiegel, über deren Werbewirksamkeit nur spekuliert werden kann. Die Wirksamkeit eines der Mariposien® ist nachprüfbar!
Helga König: Hat die ursprüngliche Idee Zukunft und können Künstler und Querdenker jüngerer Generationen auch für die Idee begeistert werden, dass das Schöne an sich das Denken und kreative Tun beflügelt?
![]() |
Helga Müller
Galeristin |
Helga Müller: Da fragen Sie mich etwas! Künstler und Querdenker, das steht außer Frage, können nicht nur – sie sind begeistert von der Philosophie und den Zielsetzungen von MARIPOSA. Das Problem sind die Führungskräfte aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft. Es ist für mich unbegreiflich, wieso nicht schon längst die "Vordenker" in den Unternehmen oder in der Politik erkannt haben, dass die Resultate, die man in Strategietagungen normalerweise erzielt, wenig Neues – vor allem Nachhaltiges – aufweisen.
Die Mehrheit der Führungskräfte weiß nicht mehr um die Bedeutung "schöner Räume und der Kunst" für den Geist und das Entwickeln kreativer Ideen. Die wahrhaft katastrophale, asymptotische Entwicklung in die falsche Richtung seit 1984 haben selbst wir in dieser Dimension nicht vorhergesehen.
Funktionale Räume schaffen funktionales Denken, das wir sicher für die Lösung praktischer Aufgaben brauchen. Kreative Ideen bringen sie nicht hervor! Sie sind überhaupt nicht geeignet, wenn es darum geht, neue Wege, neue Gedanken, neue Lösungen für welches Problem oder welche Zielsetzung auch immer!
Einstein hat einmal gesagt, man kann Probleme nicht mit denselben Methoden lösen, die die Probleme verursacht haben! Alfred Herrhausen, dem ich 1985 im Frühjahr gemeinsam mit meinem Mann als erstem Mann aus der Wirtschaft unsere Vision vorgestellt habe und der uns ermutigte, dieses Projekt anzugehen und ihn auf dem laufenden zu halten, rief mich im Sommer 1989 an und bestellte mich nach Frankfurt in die Deutsche Bank, um mir mitzuteilen, dass er ATLANTIS-MARIPOSA zur Vorstandssache der Deutschen Bank machen werde! – Aus seinem Versprechen konnte nichts werden, man hat ihn ein paar Monate später ermordet. Bis heute weiß man übrigens nicht, wer diese grausame Tat verübte. – Er konnte so ein Projekt denken, und er sagte mir, dass sein Engagement dafür nicht rein philanthropischer Natur sei, denn so – Originalton: "Wissen Sie, warum ich mich zu diesem Schritt entschieden habe? Ich verkaufe etwas, das verkauft die Chase Manhattan ebenso wie die benachbarte Commerzbank, nämlich Geld! Wenn ich meine Klientel erweitern möchte, muss ich als Vorstand dieser Bank etwas für die Gesellschaft tun. Und ich halte Ihr Projekt für eines der chancenreichsten, für diese Gesellschaft und für ihr Wertesystem, das einer schleichenden Inflation unterworfen ist. Denn Schönheit und Kunst sind unschätzbare Stimulatoren für das individuelle Wertesystem. Ohne solche Werte wird diese Gesellschaft keine echte Zukunft haben!."
Ob die MARIPOSA–Idee Zukunft haben wird, liegt nicht an der Idee an sich – sie steht und fällt mit der Fähigkeit, die Bedeutung dieser Idee auch zu erkennen und den Ort zu nutzen. Neue Ideen brauchen Menschen, die sich auf Experimente einlassen – manchmal auch, sie finanzieren zu helfen. Die Finanzkrise im Jahr 2008 hat gezeigt, dass unsere Führungskräfte in Politik und Wirtschaft SEHR experimentierfreudig sind – wie ich meine aber bei irrigen Ideen… Wir werden alle dafür bezahlen müssen. Sie werden uns nicht weiterführen…
Liebe Frau Müller, ich danke Ihnen sehr für dieses aufschlussreiche Interview
Ihre Helga König







%2BGuido%2BKarp.jpg)








.jpg)


.jpg)
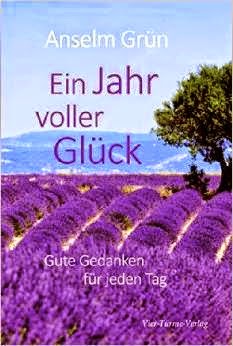.jpg)
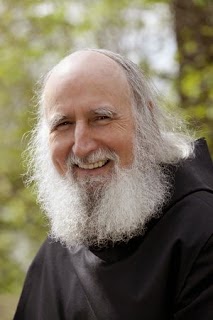.jpg)
%2B(1).jpg)









.jpg)





.jpg)

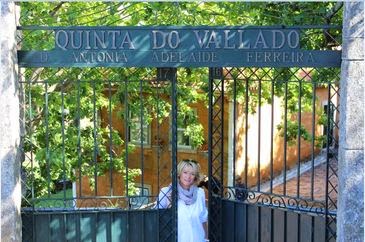

12.jpg)

.png)




.jpg)



%2BElisabeth%2BMuth.jpg)

%2B(1).jpg)

%2B(1).jpg)
.jpg)








